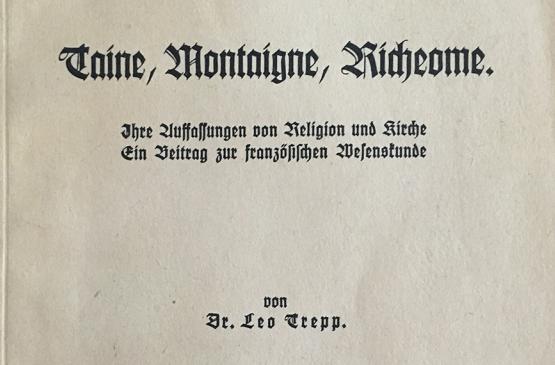Einige Betrachtungen der Kirche und der Juden nach dem Holocaust
In all meinen Lehrtätigkeiten, meinen Schriften und Publikationen – sowohl im Englischen als auch im Deutschen – war es immer mein primäres Anliegen, Studierenden und „Durchschnittsmenschen“ das Judentum nahezubringen, um es relevant zu machen für ihr Leben. Forschung im Sinne eines Aufbrechens zu Neuland und der Entdeckung von „Hiddushim“ war eher von nachgestelltem Interesse in meinem Schaffen. Selbst als Wissenschaftler bin ich bewusst ein Rabbiner, ein „Lehrer“, geblieben. Lassen Sie mich also als Tam auftreten, als einfacher, fragender Mensch.
Die Haggada beschreibt es als erstrebenswert, den „Tam“ anzuhören.
Dem „Tam“ ist es möglich, die Auslegungen, die den anderen Söhnen gegeben wurden, zu durchdringen und die sachdienliche Frage „mah zot“ zu stellen – was tust du, was sind der Kern und das ultimative Ergebnis deiner Überlegungen, gerade für das allgemeine Volk? Und er bekommt eine klare Antwort: „Gott hat uns mit starker Hand aus Ägyptenland geführt“, darum feiern wir.
Der Tam beobachtet emotional und reagiert dann intellektuell, indem er die von den Gelehrten erläuterten Theorien mit dem wahren Leben verknüpft. Und aus diesem Grund sollte er im Rat der Weisen gehört werden. Er ist ein wesentlicher Teil der (H)aggada.
Dies trifft besonders auf die Haltung des Christentums gegenüber den Juden seit dem Holocaust zu.
Ich sehe mich also in der Rolle, die Reaktion der einfachen Leute vor die Weisen zu bringen. Selbst Hillel scheint ziemlich positiv über die sogenannten einfachen Menschen zu denken (siehe B. Pessahim 66a).
Die Bedeutung des Holocaust aus persönlicher Sicht
Was also bedeutet der Holocaust für mich? Ich habe mich schlicht mit einer der Slichot des Jom Kippur beschäftigt, dem Bericht über den Märtyrertod der zehn Rabbiner, die von den Römern unter Kaiser Hadrian hingerichtet wurden. Es tut nichts zur Sache, dass der Bericht einige historische Ungenauigkeiten aufweist. Geschrieben von einem mittelalterlichen Dichter, der die Auslöschung der Juden während der Kreuzzüge selbst erlebt hat, verbindet seine Chronik die Vergangenheit mit der Gegenwart.
Er öffnet mit den Worten: „Rabbiner Jishmael reinigte sich selbst und verkündete ehrfürchtig den Namen [Gottes], und fuhr auf in den Himmel und fragte den in Leinen gewickelten Mann [Engel]. Dieser antwortete ihm: ‚Nehmt es auf euch, ihr Zaddikim und Geliebten, denn ich habe von hinter dem Vorhang gehört, dass dies der Weg ist, auf dem ihr scheiden werdet […]“. Für den Schreiber wie für den Leser gibt es keinen Zweifel daran, dass Gott der lebendige Gott ist, sein Schweigen wird nicht hinterfragt, nur das Rätsel über sein Urteil bleibt und, als Reaktion, der Gehorsam in der Heiligung Seines Namens. Es gibt keine Schuld, sie sind Gottes geliebte Kinder.
Dieses vielleicht „primitive“ Denken ruht auf zwei Elementen:
Meine Mutter ist im Holocaust ermordet worden. Sie war eine Frau tiefster Frömmigkeit und voller Liebe zu Gott, die sich an Mitzwot erfreute und sich mit Herz und Seele um ihre Kinder und Familie kümmerte. Es würde mich zerrütten, annehmen zu müssen, dass sie nur zufällig gestorben ist, und ich weiß, dass sie nicht aufgrund irgendeiner Schuld sterben musste. Ich muss aus existenzieller Notwendigkeit heraus annehmen, dass Gott lebt, und dass göttliche Fügung auf einem Plan ruhte und ruht, den wir als Menschen unfähig sind zu erkennen. Die Worte der Slichot haben darauf Antwort gegeben.
Elie Wiesel scheint dieses Gefühl exakt wiederzugeben, indem er schreibt, dass jede theologische Erklärung des Holocaust eine Blasphemie wäre und der Holocaust vielmehr als eine Warnung an die Menschheit dienen und „Rachamim“ – Erbarmen – erwecken sollte.
Das zweite Element ist die persönliche Erfahrung. Es war früh am Morgen, um uns herum noch Nacht, und ein Nieselregen fiel auf die stumme Masse der Gefangenen, die aufgereiht auf dem Paradeplatz des Konzentrationslagers Sachsenhausen standen, um immer wieder aufs Neue durchgezählt zu werden. Scheinwerfer bewegten sich hin und her über die stumme Masse. Dann tauchte der Kommandeur des Lagers auf dem Turm auf, um eine Tirade loszuwerden: „Ihr seid der Abschaum der Erde; ihr seid überhaupt keine Menschen; egal wer von meinen Männern euch umbringt, er hat etwas Gutes gemacht; ihr habt es nicht verdient zu leben […]“. Ich war mir sicher, dass er seinen Truppen, die um uns herum aufgestellt waren, befehlen würde, uns mit ihren Maschinengewehren niederzumähen. Ich sagte „Schma Yisrael“. In diesem Moment spürte ich die Gegenwart Gottes. Er selbst war in dem Lager, ertrug freiwillig Gefangenschaft und Folter. Ich sprach zu ihm, „wenn es Dein Wille ist, dass ich mein Leben für Dich hingebe, bin ich darauf vorbereitet und bereit“, und ein tiefer, nahezu gelassener Friede legte sich auf mich. Ich wusste, dass Gott genau dort war. Seit diesem Tag bin ich „Tam“ geblieben und kann Gott niemals verleugnen oder vom Tod Gottes sprechen. Er war dort. Er lebt.
Daher ist Gott für mich die ultimative Grundlage meines Lebens und Quelle meiner Werte.
Der Holocaust und die Welt
Die Juden sind die Bewahrer der Erinnerung an den Holocaust und müssen als solche gewürdigt werden.
Doch der Holocaust war ein Ereignis, das auch in die Erinnerung des Christentums aufgenommen und dort verinnerlicht werden sollte, und das eine Schwerpunktsetzung in der christlichen Theologie und Liturgie erfordert. Als Christen Juden für das „Verbrechen“ des Jüdischseins umbrachten, blieb die Welt der Christen still. Bislang, wie es mir erscheint, hat der Holocaust noch nicht wirklich in das Gedächtnis der christlichen Gemeinschaft gefunden. Zwar hat er zu einem Bewusstsein dafür geführt, dass etwas für die Juden getan werden müsse, um eine Wiederholung zu verhindern, auch wenn das auf so viele Menschen zutrifft, die in der Welt leiden. Doch der Holocaust bildet noch kein spirituelles Element, seine Opfer werden nicht als Märtyrer begriffen. Er hat nicht zu einer spirituellen Erneuerung der Gläubigen geführt und zu einer Gestaltung des Bewusstseins, die seine Wiederholung verhindert.
Eine der größten Herausforderungen wird es sein, Wege und Mittel zu finden, um durch die Lehren der Kirche einen neuen Geist zur Masse der Gläubigen zu tragen, zum „Tam“, zum „Am Haaretz“, zu demjenigen, der mit Vorurteilen beladen ist, um eine Erinnerung zu schaffen, die sich überschneidet mit der jüdischen, ohne in irgendeiner Weise die Unterschiede zu verwischen. Und dann die Reaktionen des gemeinen Volkes abzuwarten, um zu herauszufinden, ob der Holocaust das Christentum tatsächlich berührt hat, jenseits von symbolischen Äußerungen von Trauer und Reue, und ob er die christlichen Gläubigen wirklich dazu gebracht hat, mit den Juden für „Tikkun Olam“ zu arbeiten.
Einige Episoden
Martin Buber sagte mir einmal, einer der besten Wege, Ideen zu vermitteln, sei, sie in Begebenheiten zu veranschaulichen. Ich nehme mir daher die Freiheit, einige Begebenheiten einzuführen.
1. Ich arbeite als jüdischer Kaplan des Veterans‘ Home of California. Auf das Drängen des katholischen Kaplans hin, unterstützt von den Episkopalen, wurde der Magen David permanent an der Frontmauer der Kapelle befestigt. Das Kreuz steht auf dem Altar darunter und wird zu jüdischen Festen entfernt, wenn der Toraschrein benutzt wird. Der katholische Priester musste die Verwaltung und die 1400 Mitglieder des Hauses überzeugen, dass dieser Bezug auf die jüdischen Ursprünge des christlichen Glaubens angemessen und richtig für den christlichen Gottesdienst sei, und dass das Kreuz darunter das Judentum als Quelle des Christentums verdeutlichte.
2. Bei einem Abendessen zu Chanukka stand ein einfacher Jude auf und sagte, „hätten die Makkabäer ihren Kampf verloren, dann gäbe es auch kein Christentum“, und der anwesende Priester stimmte zu.
3. Ein Bewohner des Veteranenheims, ein alter, eher orthodoxer (und jüngst verstorbener) jüdischer Mann, für den das Judentum die Kraft des Lebens darstellte, ging regelmäßig zur katholischen Messe, weil er den Priester so mochte. Er nannte ihn in Jiddisch „goldener Mensch“. Er meldete sich oft, wenn der Priester während der Messe „zum Gebet für die Gläubigen“ einlud. „Ich möchte jetzt ein Lied zu Ehren Gottes singen.“ Was der alte Mann auf Jiddisch oder Hebräisch sang und der Gemeinde übersetzte, passte in den Gottesdienst. Der Priester und die Gemeinde dankten ihm jedes Mal.
So etwas wurde nicht erlaubt und wird auch in Zukunft niemals erlaubt werden, um Unterschiede im Gottesdienst und die absolute Hingabe der jeweiligen Mitglieder verschiedener Glaubensrichtungen zu kompromittieren oder auszuhöhlen.
4. Mich hat es sehr bewegt, als die Frau unseres Nachbarn, eine tiefgläubige Katholikin, meiner Frau dabei half, alles für ihren Krankenhausaufenthalt herzurichten, ihren kleinen Koffer vorbereitete, sie beruhigte und sich schließlich darum kümmerte, dass sie auf jeden Fall ihr Gebetsbuch dabei habe.
5. Oberlauringen, der Geburtsort meiner Mutter z‘l, ist ein kleiner Ort in Franken. Er hatte einst eine große jüdische Gemeinde. Während meiner Kindheit verbrachten wir alle unsere Sommer dort. Im letzten Sommer veranstalteten wir auf Initiative des Dorfpriesters hin einen überkonfessionellen katholisch-protestantisch-jüdischen Gottesdienst in der Dorfkirche. Als ich in meiner Predigt erklärte, dass es für mich 70 Jahre gedauert habe, um die Distanz zwischen der Synagoge, die einst im Dorf stand, und der Kirche, die hoch oben auf dem Berg lag, zu überwinden, begann der Baron, dessen Vorfahren damals die Ansiedlung der Juden erlaubt hatten, zu weinen.
6. Als Professor für Jüdische Studien an der Universität Mainz, an der ich ein Semester im Jahr unterrichte, war ich tief erschüttert, als ich die Dissertation eines Doktoranden las, die ich als Mitglied des Prüfungsausschusses begutachten musste. Er charakterisierte die Juden als heimatlose Wanderer, die sich mit der Sprache und der Identität ihrer „Gastländer“ tarnten. Er behauptete, dass sie keine wahrhaften Werte hätten, da der Talmud alles relativiere und dass ihre Waffe in einem zynischen Humor liege, der alle Werte entwerte. (Seine Dissertation befasste sich mit „Woody Allen in der Jüdischen Tradition“.) Der junge Mann war keineswegs ein Judenhasser, er hatte tiefes Mitgefühl für das, was im Holocaust passiert war. Er war der Meinung, dass er mit seiner Dissertation etwas Gutes für die Juden tat. Er wusste es schlicht nicht besser. Hier traten die Auswirkungen von jahrhundertelanger Indoktrinierung zutage, die auch durch die Lektionen des Holocaust nicht abgemildert worden waren.
Die Begebenheiten offenbaren mehrere Einstellungen in der Beziehung zwischen Christen und Juden. Die ersten drei sprechen von Dingen, die gemeinsam mit den Juden unternommen wurden, die vierte erläutert, was für die Juden getan werden kann, im Geiste der Anerkennung und Empathie, die fünfte spricht von symbolischen Beziehungen, doch erklärt auch, was für die Juden getan werden könne und getan wurde, die sechste zeigt eine Haltung, die sich über Juden stellt, die sich aus der jahrhundertelangen Indoktrinierung und aus falschen Lehren ergab.
Mein Ausgangspunkt ist diese sechste Episode. Sie weckte einmal mehr in mir die oft im Verborgenen schlummernde und doch fortwährende Sorge, was die Welt, einschließlich der Kirchen, von uns, den Juden, denke, und wie uns dieses Denken betrifft. Kann ich bestenfalls ein geistiges Tolerieren erwarten? Wird der heilige Glaube, der mich stärkt, wenn auch nicht mehr als Objekt des Spottes, so doch als Objekt der Herablassung fortbestehen? In dem Versuch, gut zu den Juden zu sein und etwas Gutes für sie tun zu wollen, verfing sich der junge Mann in dem, was ihnen über die Jahrhunderte angetan und ihnen nachgesagt wurde, und es war falsch und verletzte mich.
Dennoch haben diese Haltungen in ansteigender Ordnung ihre Bedeutung: vom Symbolischen hin zum Tun, getragen vom Denken über die Juden, zum Tun für die Juden und schließlich mit den Juden. Ich habe versucht, ein paar Erklärungen zu finden.
An die Erinnerung anknüpfen
Jede Gemeinschaft wird von ihrer Erinnerung bestimmt. Diese Erinnerung ist selektiv und teils sogar fiktiv. Diejenigen, die die Erinnerung vollständig teilen, bewegen sich „innerhalb“ der Gemeinschaft, während diejenigen, die diese nicht teilen, „außerhalb“ sind; Gemeinschaften, deren Erinnerungen sich überschneiden, können „miteinander“ sein.
Die Nazis stellen ein schreckliches Beispiel einer fiktiven Erinnerung dar. Ihnen gelang es, dem Volk einzureden, dass die Juden keinerlei Erinnerung mit der menschlichen Rasse teilten, sie standen vollkommen „außerhalb“ der Gemeinschaft, ihre Auslöschung stellte daher kein ethisches Problem dar.
Als sich dann diese Art von Antisemitismus an der existierenden Flamme der Herablassung und Vorurteile entzündete, breitete sich der Holocaust zu einem Flächenbrand aus, der Christen und Juden umgab, von beiden Opfern erforderte, indem er die Seele der einen Gemeinschaft zerstörte und die Körper der anderen.
Der Doktorand teilte keine Erinnerung mit den Juden und konnte sie beim besten Willen nicht von innen – aus ihrer eigenen Sicht – sehen, auch wenn er herablassend über sie schreiben konnte, so wie er sie von außen sah.
Christen haben ihre Erinnerung und Juden ihre. Unsere Aufgabe, sollte ich richtig liegen, mag dann darin bestehen, die weiten Bereiche zu verdeutlichen, in denen sich beide überschneiden, und die fiktiven Erinnerungen zu beseitigen, damit sie miteinander sein können.
Dies soll keineswegs die dauernden Unterschiede in den jeweiligen Erinnerungen der Christen und Juden überspielen. Doch mag dieser Schritt zu einer Empathie und so auf Seiten der Christen zu einem Versuch führen, den Holocaust und die Wiedergeburt des Staates Israel zusammen mit den Juden zu verstehen, bzw., soweit es menschlich überhaupt möglich ist, aus der innerjüdischen Sicht. Auf auf Seiten der Juden mag er den Versuch erlauben, das Christentum von innen heraus zu verstehen.
Herablassung muss endgültig beseitigt und mit der gegenseitigen Anerkennung, der Anerkennung gemeinsamer Elemente in der Tradition und der gemeinsamen Erfahrung ersetzt werden, um letztlich eine einheitliche lebendige Erinnerung zu schaffen.
Versuche auf Seiten der Juden
Ich glaube, dass die Juden einen Versuch unternommen haben. Um ein paar Beispiele zu nennen: Ihrer Lehre nach haben alle Rechtschaffenen der Erde einen Teil an der zukünftigen Welt (Tosefta Sanhedrin 13:21), die Juden haben diese „Rechtschaffenen“ als diejenigen definiert, welche die Gebote Noahs befolgen (Gen. Rabb. Noah 34:8), einfache und grundlegende Elemente universeller Ethik und Überzeugungen. Sie haben erklärt, dass derjenige, der dem Götzendienst abschwört, als Jude angesehen werden kann (B. Megillah 15a), und sie erkennen die christliche Gottesvorstellung als Monotheismus an. Salomon ibn Gabirol konnte in „Keter Malkhut“ sagen, dass „sie nach demselben Gott streben, auch wenn sie jemand ‚anderen‘ neben ihm anerkennen“. Und Maimonides, obgleich er kritisch war wegen der Leiden und Verletzungen, die im Namen Jesu von den Christen an den Juden begangen wurde, erkannte den Verdienst der Christenheit und des Islam an, die Tora und die messianische Hoffnung zu den entferntesten Inseln getragen zu haben […] („Könige“, gegen Ende des 11. Kapitels, das von christlicher Seite aus zensiert wurde). Und in bedeutsamer Weise wurde dies auch von Rabbiner Jacob ben Meir, „Rabbenu Tam“, ausgedrückt, der im Jahre 1147 selbst ein Opfer grausamer Verfolgung in Frankreich gewesen war (siehe: Tossafot „Assur“, B. Sanhedrin 63b).
Buber konnte Jesus seinen Bruder nennen, und Franz Rosenzweig verkündete die Notwendigkeit der Christenheit, die Menschheit zum Vater zu führen.
Die Rabbiner haben stets die Würde aller Menschen sowie ihre Gleichheit betont (Abot 3:18, B. Sanhedrin 4:5). Sie haben den Juden dazu aufgerufen, jeden Hungrigen zu versorgen, jeden Nackten zu kleiden, jeden Trauernden zu trösten, ganz gleich welchen Glauben sie haben „damit der Friede erhalten bleibe“ (Jer. D’mai 4:6).
Diese Botschaft muss natürlich auch weiterhin unter den Juden verbreitet werden.
Christliche Antworten
Dass diese Sicht in Bezug auf die Juden bis zur Mitte unseres Jahrhunderts nicht von den Christen geteilt wurde, muss hier nicht detailliert geschildert werden. Die Worte von Papst Pius XII – „das Judentum ist unsere Mutter“ – das Willkommen von Papst Johannes XXIII für eine jüdische Delegation – „ich bin Joseph, euer Bruder“ – und in erster Linie die „Nostra Aetate“ und die nachfolgenden Verkündungen der katholischen Kirche sowie der protestantischen Kirchen, können uns einen neuen Weg weisen, wenn sie die Gläubigen wirklich in der Tiefe erreichen.
Einige Gedanken zu den bevorstehenden Aufgaben
Das Judentum hat eine universelle Botschaft und Funktion für die gesamte Menschheit. Daran halten die Juden innig fest, und Hans Küng hat es aus christlicher Sicht in seinem letzten Werk „Die Juden“ hervorgehoben. Es könnte im Christentum als lebendige Erinnerung eine Lebenskraft sein, der Gedanke hat sich aber noch nicht allgemein durchgesetzt. Die Erinnerung wurde bislang nicht wachgerufen, wie die Dissertation des jungen Mannes so deutlich offenbart hat. Die Aufgabe, das zu ändern, wird nicht einfach.
Im Neuen Testament werden „die Juden“ als Widersacher gegeißelt, sie sind „außen vor“ und das christliche Gedächtnis wird diese Beschreibung „des Juden“ behalten. Eine Revision des Textes mag schwierig sein, einige überarbeitete Versionen des „Neuen Testamentes“ wurden eingeführt, doch alle Bibeln, die künftig gedruckt werden, sollten zumindest Fußnoten aufweisen, die bei jeder Gelegenheit die Aussagen gegen „die Juden“ klären.
Ich würde mir wünschen,
dass es verpflichtende Kurse zum Judentum in den Lehrplänen aller theologischen Fakultäten gäbe, die es als einen lebendigen Glauben aus sich selbst heraus darstellen und nicht als einen überkommenen Vorläufer des Christentums,
dass die Geistlichen lernen, aus den hebräischen Schriften, dem „Alten Testament“ zu predigen, und dass der Begriff „Altes Testament“ durch „Hebräische Schriften“ ersetzt würde,
dass sich Christen bewusst werden, dass „der Gott der Juden“ des „Alten Testaments“ mitfühlend und gnädig ist und die Erlösung bringt,
dass Christen verstehen lernen, dass Juden die Mizwot nicht als Last ansehen, sondern als ein Geschenk, und dass Juden nicht von ihren „Werken“ abhängig sind,
dass Christen die ethische Größe und Besonderheit der Pharisäer gezeigt wird,
dass Christen lernen, den einzelnen Juden und den Staat Israel nach denselben Maßstäben zu bewerten, wie andere Personen und andere Staaten, etc.,
Rundum, dass eine Erinnerung, die unterdrückt, vergessen oder verzerrt wurde, wiederhergestellt wird.
Vor einigen Jahren nahm ich an einem deutschen „Kirchentag“ in Augsburg teil. Auf einem der Haupttreffen suchten die Theologen, die einen Workshop zu sozialer Gerechtigkeit leiteten, verzweifelt nach der Begründung für diese Pflichten in der Schrift. Während der Fragerunde ging ich zum Mikrofon, doch die Diskussionszeit war abgelaufen, bevor ich es überhaupt erreicht hatte. Ich hätte einfach gesagt: „Fragt die Propheten Israels und ihr werdet eure Grundlage finden“. Offensichtlich war das „Alte Testament“ in den Hintergrund gerückt und von den Theologen gar nicht berücksichtigt worden.
Kirchenführer und Theologen haben Fortschritte gemacht. Die Frage ist nur, wie weit und wie tief die Gläubigen davon betroffen sind und sich entsprechend verändert haben. Die Beseitigung anti-jüdischer Aussagen und Gebete ist ein großer Schritt vorwärts. Darüber hinaus müssen Juden vielleicht wieder einen Platz im Gedächtnis des Christentums finden. Das Jüdisch-Sein Jesu sollte bekräftigt werden.
Jeder Gottesdienst beinhaltet eine Lesung aus dem „Alten Testament“. Könnte es nicht mit den folgenden Worten eingeleitet werden: „Wir bekommen nun Anweisung und Führung aus Gottes Wort, wie es den Juden, unseren Brüdern und Schwestern, offenbart und uns weitergegeben wurde“?
Als eine der Präventivmaßnahmen, die eine lebendige Erinnerung schaffen könnte, halte ich eine breite missionarische Aktivität in den Kirchen der afroamerikanischen und lateinamerikanischen Gemeinden für sinnvoll, denen eine verzerrte Erinnerung über die Juden und das Judentum vermittelt wurde, mit dem Ergebnis, dass sich in großen Teilen dieser Gemeinschaften ein hartnäckiger Antisemitismus entwickelt hat.
Das gleiche gilt für die Völker, die bislang noch keinen Kontakt mit den Juden und dem Judentum oder noch kein Bild von ihnen hatten.
Indem ihnen bewusst wird, dass „was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, ihr mir getan habt“, muss den Gläubigen der Mut und die Hingabe vermittelt werden, immer wieder ohne Furcht gegen die Demagogen und die radikalen Störenfriede vorzugehen, nicht nur, weil diese andere angreifen, sondern auch weil sie das Wort Gottes ausschlagen.
Im Interesse der Kirche sehe ich die Notwendigkeit, jeder Verletzung der Trennung von Kirche und Staat entgegenzutreten. Anderenfalls können am Ende, wie uns die Geschichte so deutlich gezeigt hat, Kirche und Synagoge zu Subjekten des Staates werden.
Als ich das Gymnasium in Deutschland besuchte, wurde zu Beginn jeden Tages ein Gebet gesprochen, und der Religionsunterricht zweimal in der Woche war Pflicht. Das Gebet verkam zu einem Witz und etwas Geringgeschätztem. Weder das Gebet noch der Religionsunterricht hielten irgendjemanden davon ab, ein Nazi zu werden.
Für viele Eltern war „Religion“ in der Schule eine Entschuldigung, ihrer eigenen Pflicht, ihr Kind religiös zu erziehen, nicht nachzukommen. Nur diejenigen, die zuhause eine wirklich religiöse Erziehung genossen hatten, waren gegen die Indoktrinierung der Nazis immun, und einige dieser Klassenkameraden sind bis heute meine Freunde geblieben.
Die Trennung der einzelnen Glaubensrichtungen für die Religionskurse verhinderte jede Form von gemeinsamer Erinnerung.
Die Abhängigkeit vom Staat hinderte die Kirche daran, sich der Judenvernichtung durch die Nazis zu widersetzen, auch wenn sie es gewollt hätte. Selbst die „Bekennende Kirche“ hatte keine Erinnerung der Juden, die der Wirklichkeit entsprach.
„Religion“ in der Schule, wie sie durch den Staat gesteuert wurde, hat vielleicht sogar die Ideologie der Nazis gefördert.
Die Bindung an den Glauben durch die Kirche und das Zuhause scheint mir ein besserer Garant für die religiöse Zukunft unserer Gesellschaft zu sein, als für staatliche Unterstützung für Gebet und religiöse Aktivitäten zu plädieren. Auf dem Staat zu beruhen zeigt Schwäche und öffnet schließlich staatlichen Eingriffen die Tür.
Doch gleichzeitig muss die Kirche ihre Stimme erheben und ihre Kraft einzusetzen, um gegen jegliche Form sozialer Ungerechtigkeit zu kämpfen und für soziale Gerechtigkeit einzustehen. Stünde sie zusammen mit den Juden dafür ein, könnte sie sich gleichzeitig der gemeinsamen Fundamente und Prinzipien sozialer Gerechtigkeit bewusst werden. So würde die gemeinsame Erinnerung gestärkt und das gemeinsame Bemühen effektiver.
Dieser Ruf geht an jedem Jom Kippur an die Juden aus. Der Kern von Religion besteht darin, „die Fesseln, die Menschen zu Unrecht binden, zu lockern, den Unterdrückten zur Freiheit zu verhelfen, jedes Joch zu durchbrechen, das Brot mit den Hungrigen zu teilen, die Heimatlosen bei sich aufzunehmen, den Nackten zu kleiden, wenn man auf ihn trifft, und sich nicht vom eigenen Fleisch abzuwenden […] (Jes. 58:6 ff). Dies wird, wie wir oben gesehen haben, von den Weisen des Talmuds wiederholt.
„Weise ist der, der die Konsequenzen der Dinge voraussehen kann, die entstanden sind.“ (Tamid 32a) Und ich füge hinzu: Ich vertraue darauf, dass jeder sie in seiner Weisheit voraussehen kann.
Die Erfahrungen des Holocaust haben für mich ein Licht auf den Ausspruch „Armut gleicht dem Tod“ (Nedarim 7b) geworfen, der während meiner Jugend oft zitiert wurde. Damals bedeutete er für mich, dass die Armen wie ein toter Körper herumgestoßen werden können. Im Angesicht des Holocaust bedeutet er für mich heute: „Wenn wir Armut zulassen, töten wir.“
„Sorge dich um die Kinder der Armen, denn von ihnen wird die Tora weitergetragen.“ (Nedarim 81a) – solange wir ihnen ein würdiges Leben und eine gute Ausbildung ermöglichen.
Alle diese Aufgaben werden dann zu unausweichlichen Pflichten einer gemeinsamen Erinnerung im Angesicht des Holocaust.
Der Staat Israel
Gäbe es eine lebendige Erinnerung, dann würden die Kirchenleitungen verstehen, dass, insbesondere nach dem Holocaust, Israel nicht lediglich das Produkt jüdischen „Nationalismus’“ ist, sondern ein Wunder, in anderen Worten, eine große Tat Gottes, eine lebendige Haggada. Für die Juden ist Israel ein Element des Glaubens, das für die ganze Welt eine große Bedeutung trägt: eine Manifestierung des göttlichen Wortes als etwas Aktives und Lebendiges.
Um es mit den Worten Abraham Heschels auszudrücken, „[…] das Wort [Gottes] wird nicht [effektiv] von Israel ausgehen, solange wir nicht alle – Juden wie nicht-Juden – die intensive Erfahrung gemacht haben, auf das Wort zu warten. Es ist unsere Bürde als Juden und dennoch werden wir nicht und müssen wir nicht allein damit umgehen. Wir alle müssen lernen, wie wir inmitten dieser grausamen Leere in unserem Leben schöpferisch sein können und wie wir uns von einer Hoffnung erhellen lassen, trotz allem Unglück und aller Bestürzung. Die Bibel ist ein unvollendetes Drama. Unsere Anwesenheit in unserem Land ist nur ein Kapitel eines allumfassenden, bedeutungsschweren Dramas. Es umfasst ein Teilen des Bewusstseins der alten biblischen Bewohner des Landes für das Verkünden des biblischen Vermächtnisses. Wie die Jakobsleiter weist es auf Jerusalem in der Höhe…
Der Staat Israel ist nicht die Erfüllung des messianischen Versprechens, sondern begründet vielmehr das messianische Versprechen.“ (Israel, an Echo of Eternity, N.Y. 1967 ff., S. 222 ff.)
Wir dürfen nicht über die vergangenen und zukünftigen Fehler Israels und seiner Regierung hinwegsehen, Fehler, wie sie alle Staaten machen.
Doch Kirchenvertreter, die ein scharfes Urteil über den Staat Israel fällen – dieses Scheit, das vom Feuer gerettet wurde – anstatt eine liebende und verständnisvolle Kritik anzubieten, haben sicher nicht das Bewusstsein der Juden in ihrer Erinnerung verinnerlicht, dass dieses Drama noch nicht vollendet, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Ihr Urteil enthält eine Art Triumphalismus, der aufgrund ihrer Macht und weltweiten Gemeinschaft von Millionen Gläubigen das Recht als gegeben ansieht, über die Überreste Israels zu richten. Und doch ist es nicht die Anzahl, die vor Gott zählt. „Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker - denn du bist das kleinste unter allen Völkern“ (Deut. 7:7).
Gleichzeitig ist jedoch auch das Christentum eine Minderheit in der Welt geworden. Die Christen werden irgendwann von den Juden lernen können, wie eine Minderheit überleben kann. Der Dalai Lama in seinem Exil versteht dies längst und hat daher im Jahre 1990 jüdische Vertreter eingeladen, um ihm Rat und Anleitung für das Überleben seines Volkes zu geben.
Das Judentum als eine Kraft für das Leben der Welt
Das Judentum kann, als eine lebendige Erinnerung im Christentum, eine Kraft im Leben der Menschheit sein.
Hermann Cohen glaubte, dass die Juden einst in die Welt gesandt wurden, um als kleine Minderheit, den Geist des „Rachamim“, des Erbarmens, in der nicht-jüdischen Mehrheit zu wecken. Die Welt hörte nicht hin.
Heute kann der Staat Israel dienen, um das „Rachamim“ der Welt zu wecken. Er ist klein. Er ist belagert. Die Verleumdung des Zionismus als Rassismus wurde endlich ausgelöscht, doch es vergeht kaum eine Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, in der nicht eine anti-israelische Resolution erlassen wird. Israel ist das einzige Mitglied, dem jeglicher künftige Anspruch auf die Präsidentschaft der Versammlung verwehrt ist.
Aus einer gemeinsamen Erinnerung heraus sollte die Kirche ihre Stimme erheben, nicht nur einmal, sondern bei jedem Vorfall, denn es sind nicht nur die Juden, die angegriffen werden, es ist die Kirche selbst, die angegriffen wird.
Kein Christ kann die Ängste und Sorgen und Unsicherheiten fühlen, die seit dem Holocaust die Seele der Juden durchziehen, die bei jedem Ausdruck des Hasses gegen wen auch immer zutage treten. Juden konnten und können mit den Unterdrückten und Verfolgten aller Völker mitfühlen, denn sie sehen in ihrem Leiden ihr eigenes gespiegelt. Sie können mit ihnen sein. „Ihr sollte den Fremdling lieben wie Euch selbst, denn ihr wart Fremdlinge in Ägypten.“ (Lev. 19:34) So ist es seit Jahrtausenden in die Erinnerung eingeflossen. Ich bete dafür, dass das Christentum dieselbe Erinnerung erlangen kann.
Christen können Juden helfen
Womöglich können Christen den Juden dabei helfen, sich ihrer inneren Gefühle bewusst zu werden und diese in ihrem Lernen und ihren Gottesdiensten auszudrücken.
Heute sind viele Juden zur Tradition oder gar zu Fundamentalismus zurückgekehrt, wie auch manche Christen diesen Schritt gemacht haben. Nachdem die menschliche Vernunft versagt hat, den Holocaust zu verhindern, sind sich diese Juden bewusst geworden, dass ihre Werte auf Gott ruhen müssen. Doch viele andere sind trotz einer starken Verbundenheit mit ihrem ethnischen Judentum nicht mehr engagiert im religiösen Leben. Sie scheinen noch immer im „modernen Zeitalter“ mit einem Vertrauen auf menschliche Vernunft zu leben.
In unserem „postmodernen“ Zeitalter kann es jedoch dem Wunsch entspringen, das Leben „in dieser Welt“ zu genießen, verbunden mit der Befürchtung, dass die Freude nicht andauert, und womöglich einer tiefsitzenden unterbewussten Hoffnungslosigkeit nach all dem, was passiert ist und dem Schweigen Gottes dazu. Nach dem Holocaust hat Gott kein Recht mehr dazu, Mizwot von uns zu verlangen, sagt der moderne orthodoxe Rabbiner Irving Greenberg.
An dieser Stelle, wie die vierte Episode verdeutlichen soll, können Christen möglicherweise eine große Unterstützung für die Juden bieten. Es war nicht nötig, dass unsere Nachbarin nach dem Gebetbuch meiner Frau suchte, denn es lag schon im Koffer. Doch allein ihre Worte spendeten Trost. Unsere Nachbarin war mit uns.
Sie wies damit auf Gott hin und auf die göttliche Fügung. Darüber hinaus zeigte sie, dass sie davon überzeugt war, dass Gott die Gebete eines Juden hört. Der jüdische Glaube wurde bestätigt.
Einem Miteinander in diesem Sinne kann sogar die Erkenntnis erwachsen, dass die Wiederherstellung des Staates Israel eine Antwort auf jüdische Gebete war und noch immer ist – ein Wunder, dessen sich diejenigen, die es erlebten, womöglich nicht einmal bewusst waren (siehe B. Nidda 31a).
Das Vorbild des christlichen Glaubens mag es einigen Juden ermöglichen, ihren eigenen Weg zu Gott zu finden und die Schönheit ihres eigenen, jüdischen Glaubens zu erkennen, aus der gefühlten gemeinsamen Erinnerung heraus, dass Gott da ist.
Ein Fazit
Franz Rosenzweig betonte, dass Judentum und Christentum füreinander unzertrennlich seien, denn beide seien nicht „gegründet“, also bewusst geschaffen worden, sondern geschahen schlichtweg, das eine durch eine historische Tatsache, das andere durch ein Erlebnis, und beide gingen als „weltliche“ Ereignisse hervor, das heißt, sie haben ihren Platz in der Welt menschlicher Ereignisse eingenommen und sind niemals „organisiert“ worden (Das neue Denken. S. 302). Auch wenn wir Rosenzweigs grundlegender Idee nicht zustimmen, dass Juden aus dem Geschichtsverlauf ausgetreten sind, können wir seine Worte als einen Aufruf verstehen, eine gemeinsame Erinnerung von Christen und Juden zu schaffen und dann entsprechend zu handeln – in Transzendenz der Geschichte.
Ich kann Bubers Kontrast, den er zwischen dem christlichen „Pistis“ und dem jüdischen „Emuna“ sieht, nicht zustimmen. Dennoch schließe ich mich seinen abschließenden Worten in „Zwei Glaubensweisen“ an, die besonders nach dem Holocaust eine Eindringlichkeit entfalten. Christen und Juden werden „einander etwas bislang Unausgesprochenes zu sagen haben und sich gegenseitig helfen können – etwas, das heute kaum zu erfassen ist“.