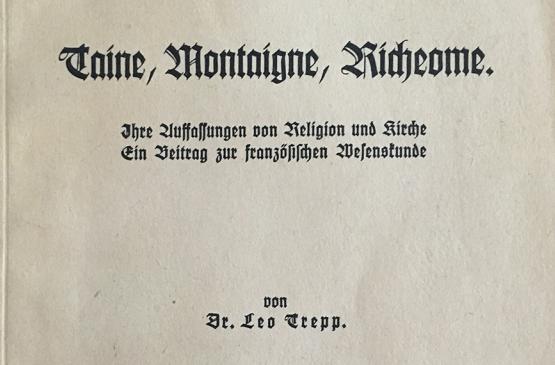Trialog der Religionen
Als ich im Jahre 1971 zum ersten Mal jüdische Wissenschaften an einer deutschen Universität (an der Universität Hamburg) lehrte, hatten der Direktor des Ökumenischen Seminars und ich die Idee, den Dialog zu erweitern, indem wir Repräsentanten des Islam einbezogen. Wir beabsichtigten, Abraham in den Mittelpunkt unseres Dialogs zu stellen, den Juden und Muslime als ihren realen Vorfahren sehen, und den Christen als ihren spirituellen Vater wahrnehmen.
Unser Treffen fand nie statt. Der muslimische Vertreter erklärte, dass er sich nicht an einen Tisch setzen könne mit einem Juden, nicht einmal in einem akademischen Umfeld.
Damals empfand ich diese Erklärung als skandalös. Ich sollte eines Besseren belehrt werden.
Wir trafen uns einzeln mit den Studenten, jede Religion stellte ihre Position dar und diskutierte sie mit den Studierenden. Einige erzählten mir, dass der Kern des muslimischen Vortrages darin bestand, Israel zu verurteilen. Als ich nach der jüdischen Position dem Islam gegenüber gefragt wurde, sagte ich den Studierenden, dass der Islam kein theologisches Problem für das Judentum sei, so wie auch das Christentum kein Problem darstelle. Gemäß der jüdischen Lehre sind die anderen Religionen zu respektieren. Auch den Nicht-Juden ist „Errettung“ – ein Platz im Himmel – zugesichert. In mancher Weise stellt der muslimische Monotheismus ein geringeres Problem für das Judentum dar als der christliche Dreifaltigkeitsgedanke. Zudem führte der Islam nicht zu einer Verurteilung von Juden, die sie für den Tod Gottes verantwortlich macht, da Jesus für sie keinen göttlichen Charakter hat.
Als ich 1979 mit einem verlängerten Lehrauftrag nach Hamburg zurückkehrte, hatte sich die Situation geändert. Die religiösen Autoritäten des Islam hatten beschlossen, dass der Dialog zwischen Muslimen und Juden und Christen außerhalb der Islamischen Sphäre erlaubt sei.
Meine Anwesenheit an der Universität wurde vom Leiter des Ökumenischen Seminars als Chance gesehen, das Experiment zu wiederholen. Auf die Einladung erfolgte prompt die begeisterte Antwort der muslimischen Wissenschaftler. Als Jude, der theologisch zwischen dem Christentum und dem Islam stand, wurde ich von den muslimischen Teilnehmers als erste Wahl zum Moderator gesehen.
Es wurde deutlich, dass sich diese Wissenschaftler an den westdeutschen Universitäten nach Kontakten sehnten. Bis zu dieser Zeit waren sie von ihrer Furcht vor den Autoritäten zu Hause zurückgehalten worden. Der Mann, der seine Beteiligung bei dem Treffen acht Jahre vorher verweigert hatte, wurde einer der offensten Fragesteller und Diskussionsteilnehmer. Es war offensichtlich, dass er vorher Anordnungen gefolgt war. Ich kann nicht sagen, ob die Erfahrung, eine frühere Teilnahme auf Druck absagen zu müssen, seinen Sinneswandel eingeleitet hatte, doch in der Zwischenzeit war er zum seriösesten Kritiker des Khomeini Regimes geworden, der unverblümte Artikel in deutschen Zeitschriften veröffentlichte.
Diese Männer waren sich sehr wohl bewusst, dass das islamische Recht modernisiert werden muss, um dem Standard unserer Zeit zu entsprechen, besonders im Hinblick auf das Rechtssystem und die Rechte von Frauen. Ihre Sorge hat nicht nur ethische Motive. Sie befürchten, dass früher oder später das moderne Denken auch die Menschen in den islamischen Ländern erreichen und für sich gewinnen könnte. Eine solche Welle könnte, so befürchten sie, auch für den Islam die ernste Gefahr des Kommunismus mit sich bringen.
Die muslimischen Vertreter kamen als Verteidiger des Islam und als Lernende. Manche waren mutig – zumindest während der privaten Zeit unseres Treffens – andere, wie beispielsweise der Imam der lokalen Moschee, waren liebenswürdig, aber zurückhaltend. Insgesamt repräsentierten die Muslime die Einstellung, die einst den christlich-jüdischen Dialog geprägt hatte: „Lasst uns über das ‚Gute’ sinnieren, das uns vereint, ohne zu viel Augenmerk auf das zu richten, was uns trennt.“
Doch wir hatten uns für einen anderen Ansatz entschieden. Ein Vertreter jeder Gruppe sollte eine Perikope oder einen Teil seiner heiligen Schriften vorstellen. Damit konnten wir gleichzeitig zeigen, wie solche Möglichkeiten zu nutzen sind, um eine positive Einstellung gegenüber anderen Religionen zu schaffen.
Ein Sprecher hatte die Perikope der aktuellen Woche in den protestantischen Kirchen gewählt. Es er, dass diese mehrere Verurteilungen „der Juden“ beinhaltete. Es folgte eine heftige Debatte. Die Katholiken betonten, dass die Wahl der zu verlesenden Schriften jedes Jahr den zentralen Autoritäten zustand, und dass diese Autoritäten wiederum von den Erklärungen des II. Vatikanischen Konzils angeleitet seien. Die Protestanten machten geltend, dass der Ablauf feststehe und dass der Pastor in seiner Predigt den Inhalt der Schriften erklären könne. Einige der jüdischen Vertreter waren erbost und verlangten eine Revision des Textes, was natürlich unmöglich ist. Man stimmte darin überein, dass der durchschnittliche Pastor in seiner Predigt wohl keine Erklärung mitliefern würde, wenn ein kontroverses Thema behandelt werde. Zudem wurde eingewandt, dass viele Protestanten die Bibel allein lesen, ohne jede Anleitung. Die Schlussfolgerung war, dass die autorisierten Übersetzungen des Neuen Testaments Fußnoten zu jeder anti-jüdischen Aussage bräuchten, welche die Bedeutung des Textes mit Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse und die „neue Theologie“ korrigierten, ganz im Geiste des Dialogs. Die Muslime nahmen an dieser Diskussion nicht teil.
Für meine Präsentation wählte ich den Abschnitt aus Genesis aus, der vom Tod Abrahams berichtet und seiner Beerdigung durch seine zwei Söhne Isaak und Ishmael (Gen. 25:8-18). Man kann eine negative Charakterisierung Ishmaels in diesen Auszug der Tora hineininterpretieren. Und dieser negative Ansatz könnte die jüdische Einstellung gegenüber dem Islam beeinflussen. Doch tatsächlich finden wir in der rabbinischen Interpretation der Tora eine sehr positive Haltung zu Ishmael. „Ishmael war ein Zaddik“, sagt der Midrasch. Sein Vater besuchte ihn mehrere Male. Er traf ihn zu Hause jedoch nicht an, so ließ er einen Rat für ihn zurück. Der ersten Frau Ishmaels mangelte an Liebe, so dass Abraham Ishmael eine Scheidung von ihr nahelegte. Ishmael gehorchte, und seine Mutter fand eine gute Frau aus Ägypten für ihn (Gen. 21:21) – was eine positive jüdische Haltung Ägypten gegenüber ausdrückt. Auch Abraham stimmte dieser Bindung bei einem zweiten Besuch zu.
Jüdische Heilige haben den Namen Ishmaels getragen. Als Ishmael starb „wurde [er] versammelt zu seinen Vätern“ (Gen. 25:17), ein Ausdruck, der bedeutet, dass er das ewige Leben im Sinne der rabbinischen Interpretation erhalten hatte. Da diese Formulierung nur für die Patriarchen gebraucht wird, zeigt er auf, dass Ishmael als ein Patriarch angesehen wurde. Isaak und Ishmael begruben zusammen ihren Vater, im gemeinsamen, brüderlichen Einvernehmen. Die Rabbiner fragten: „Warum sagt die Tora: ‚Isaak und Ishmael begruben ihn‘, wo doch Ishmael als Erstgeborener zuerst hätte genannt werden sollen?“ Und sie erwidern: „Dies war eine freiwillige Gefälligkeit und Anerkennung, die Ishmael seinem Bruder erwies. Hier war Isaak der Besitzer und Herr über das Land und hatte Vorrang.“ Es gab keinen territorialen Konflikt, der zwischen den Brüdern stand. Ishmaels Gebiet wurde ihm durch die Tora zugesichert, ein großes Gebiet, über das er der Herrscher war und das von Isaak anerkannt werden musste (Gen. 25:18). Und wie Isaaks Sohn Jakob hatte auch Ishmael zwölf Söhne, die der vollen namentlichen Erwähnung würdig waren (Gen. 25:13-16). Die zwölf Stämme Israels und die zwölf Stämme Ishmaels sind gleichgestellt.
Die Präsentation der Muslime war weniger direkt. Sie zeugte von einem Kampf. Sie bezog sich expliziter auf das Christentum, da die Kontroverse mit dem Christentum heutzutage weniger deutlich hervortritt. Die Referenzen im Koran zum Christentum sind nicht so scharf wie die zu den Juden und dem Judentum. Daneben waren die muslimischen Vertreter sehr bemüht, die grundsätzlichen islamischen Lehren nicht anzutasten. Eine Rede, die 1979 vom Großmufti aus Syrien an der Universität Wien gehalten wurde, diente ihnen als Grundlage. Der Titel der Rede „Die Einheit von Religion und der brüderliche Geist zwischen Christentum und Islam“ legte den Fokus auf das Christentum.
Die Ausarbeitung des muslimischen Sprechers bezog sich nicht auf eine Analyse eines bestimmten Textes, sondern setzte sich mit Möglichkeiten auseinander, wie das Hadith, die Äußerungen und Praktiken des Propheten Mohammeds, als Instrument für neue Ansätze dienen könne. In der Tat gibt es zahlreiche Stellen im Koran, welche die Einheit der Menschheit betonen. „Menschheit, siehe, Wir schufen dich aus einem Mann und einer Frau, und machten aus dir Nationen und Völker, damit ihr euch gegenseitig kennen lernen könnt; der, der Gott am meisten fürchtet wird als der weiseste unter euch angesehen.“
Die Diskussion des muslimischen Teilnehmers wandte sich im Grunde zwei Problemen zu: Einerseits dem grundsätzlichen Problem, dass Judentum und Christentum toleriert werden und nicht als gleichwertig anerkannt werden können. Dies hat schwerwiegende Folgen für die Gegenwart. Andererseits, dass beide Religionen – Judentum und Christentum – die ihnen zu ihrer Zeit von Gott offenbart worden sei, diese göttliche Offenbarung korrumpiert hätten und erst Mohammed sie wieder zu ihrer Reinheit zurückgeführt habe. Aus dieser Haltung heraus ist es einem Muslim erlaubt, eine jüdische oder christliche Frau zu heiraten. Doch gilt dies nicht für einen Nicht-Moslem, der eine muslimische Frau heiraten möchte, da der Mann als Gebieter gilt, der im ersten Fall über eine nicht-muslimische Frau dominieren darf, doch eine Muslima darf sich keinem Nicht-Moslem unterwerfen. Dann kam die Frage nach dem Status der Juden unter muslimischer Herrschaft auf. Sie war im Mittelalter und später nur gut, wenn man sie mit der Behandlung von Juden unter christlicher Herrschaft vergleicht, doch war der Islam die erste Macht, die eine erkennbare Markierung an der Kleidung der Juden verlangte, noch bevor die Laterankonzilien das Tragen des gelben Aufnähers und das Tragen des Judenhutes in christlichen Ländern beschlossen.
Und natürlich diskutierten wir die Frage nach den Rechten der Frau. Die Vorstellung, dass sie durch ihre Behandlung „geschützt“ würden, ist nicht mehr tragbar. An diesem Punkt schlug einer der muslimischen Vertreter vor, dass man zwischen den Äußerungen des Koran, die von Mohammed während seiner frühen Jahre in Mekka niedergeschrieben worden waren, und denen aus späteren Jahren des Krieges und der Auseinandersetzung bei Medina unterscheiden müsse. Während die ersteren die ethischen Prinzipien des Islam enthielten und einen ewigen Anspruch hätten, spiegelten die letzteren lediglich die Kontroversen und Zerwürfnisse jener Zeit und sollten nicht als dauerhafte Wahrheiten gesehen werden.
Hier wurde ein wirklich kritischer Durchbruch erzielt, der von einigen Teilnehmern nur mit Vorbehalten angenommen und von einigen der Muslime gänzlich verworfen wurde. Die Aussage war ihnen zu gewagt. Und doch lag hier der Beginn eines kritischen Ansatzes, ähnlich wie die christliche Kritik der Bibel begonnen hatte, aus der – zumindest teilweise - eine Veränderung der christlichen Einstellung hervorging.
Während einer Kaffeepause wurde mir die Frage nach Veränderung gestellt. Derselbe muslimische Wissenschaftler, der sich vor zehn Jahren noch geweigert hatte, im Rahmen einer interreligiösen Diskussion mit mir an ein und demselben Tisch zu sitzen, stellte mir die Frage: „Wie ist es möglich, dass in Israel Staat und der Gesellschaft ihren Angelegenheiten in so vieler Weise frei von der Dominanz des Rabbinats nachgehen können – etwas, das uns unmöglich ist, weil wir nicht gegen die Regeln der Mullahs handeln dürfen?“ Ich erwiderte, dass ich den Grund in der Existenz der jüdischen Diaspora sähe.
Die Existenz einer jüdischen Diaspora hat einen zweiseitigen Weg geschaffen, mit gegenseitigem Einfluss. Der Islam hat keine Diaspora gehabt. Doch so eine Diaspora entsteht derzeit und mit ihr die Aufgabe: ihren Einfluss geltend zu machen. Darauf erhielt ich zwei Antworten: Selbst wenn sie zensiert wird, werde eine muslimische Meinung, die aus der Diaspora komme, nicht ernstgenommen. Und zweitens: Muslime in der Diaspora seien befangen oder fürchteten sich davor zusammenzukommen, um gemeinsame Debatten, Diskussionen oder Resolutionen zu bestreiten. Vor einiger Zeit, erzählte er mir, hatten die Muslime Leiter und Vertreter des Islam in Deutschland aufgerufen, sich an der Konferenz zu beteiligen, doch niemand war erschienen – niemand hatte es gewagt zu kommen.
Die Frage wurde nach der Pause in runden Tischen wieder aufgegriffen. Die muslimischen Repräsentanten drückten ihre tiefe Besorgnis aus. Der Islam ist eine geschlossene Welt. Er kann aber nicht verschlossen bleiben. Wenn die moderne Welt über sie hinwegfegt, wohin werden dann die Massen strömen? Wird es genug Zeit geben, unter Druck große Veränderungen vorzunehmen? Wird der Kommunismus mit seinem Versprechen, eine bessere Welt für die Massen zu schaffen, den Glauben vereinnahmen? Die Ängste waren real. Es gab keine Antwort.
Das Treffen bestätigte mich in der Überzeugung, dass wir als Juden dem Islam viel zu geben haben, besonders da auch das Judentum Religion und Völkerschaft verbindet.